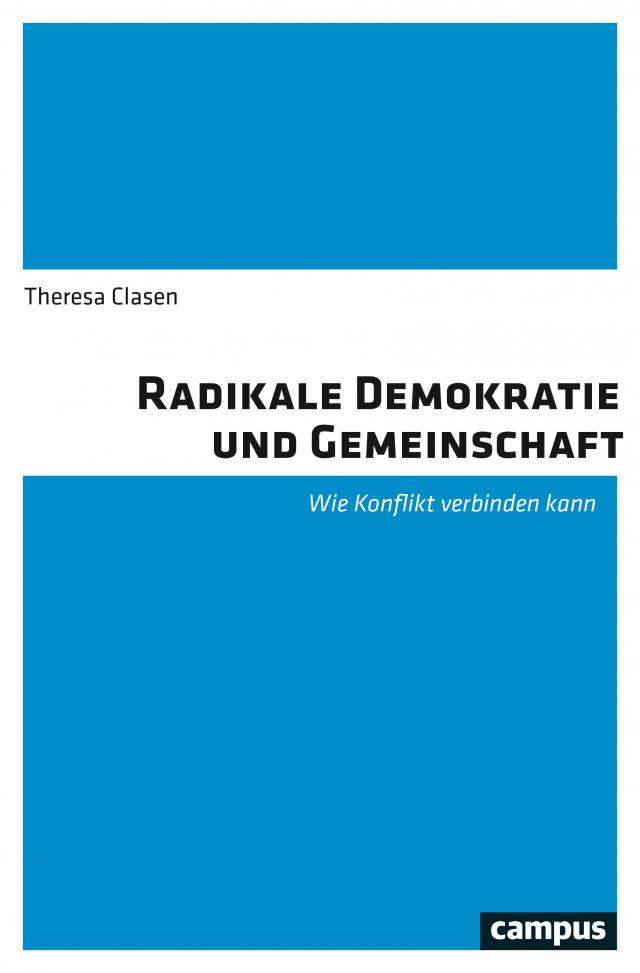
Radikale Demokratie und Gemeinschaft
Wie Konflikt verbinden kann
Articolo fuori assortimento
43,90 €
Dettagli prodotto
- Casa editrice
- Campus
- Pubblicato
- 2019
- Lingua
- Deutsch
- Pagine
- 250
- Info
- 250 Pagine
21.3 cm x 14.1 cm - ISBN
- 978-3-593-51092-7
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
Einleitung: Radikale Demokratietheorien und das Desiderat der Gemeinschaft 13
Die Anforderungen zeitgenössischer Demokratietheorien 15
Das Defizit radikaldemokratischer Gemeinschaft 24
Die sozialtheoretische Vertiefung 27
Von vorne anfangen: Gemeinschaft als Beziehung des mutual concern 29
Methodischer Ansatz und Aufbau 33
I. Die radikale Intervention und der verbindende Konflikt 37
Die Unbestimmtheit des Sozialen 39
Die radikale Negativität des Sozialen 41
Die Politisierung der Politik 45
Der antagonistische Konfliktbegriff 46
Die hegemoniale Gesellschaft und die imaginierte Einheit 50
Die Unverfügbarkeit des sozialen Zusammenhaltes
und der verbindende Konflikt 53
Das radikaldemokratische Projekt kollektiver
Selbstbestimmung 56
II. Chantal Mouffes agonale Gemeinschaft 62
Die agonistische Gemeinschaft 66
Das zivilbürgerliche Modell demokratischer Gemeinschaft 68
Die Preisgabe der Radikalität 75
Die Vernachlässigung des Sozialen 81
Die sozialtheoretische Alternative 84
III. Ferdinand Tönnies:
Zwei Dimensionen der gemeinschaftlichen Fundierung von Zusammenhalt 88
Die Gegenüberstellung der Grundbegriffe 90
Die Willenslehre 93
Der Wesenwille 94
Der Kürwille 97
Die Vermittlung der Willensformen und die politische Gemeinschaft 98
Die Unüberwindbarkeit der ursprünglichen Grundlegung 101
Die vertikale Determiniertheit des Wesenwillens 104
Zwischenresümee 106
IV. Max Weber:
Die affektive Spur der Vergemeinschaftung 109
Vom sozialen Handeln zur Organisation sozialer Beziehungen 112
Handlungen und soziale Strukturen 115
Vergemeinschaftung auf der Grundlage von Gefühlen 116
Historisch-empirische Gemeinschaften 119
Die Spur des mutual concern 122
Die Ambivalenz der Affektivität 123
Die Wertegemeinschaft 124
Das individualistische Wertefundament politischer
Gemeinschaft 127
Zwischenresümee 130
V. Émile Durkheim:
Die horizontale Begründung von sozialem Zusammenhalt 132
Das Faktum der Verbundenheit 133
Die vertikal begründete mechanische Solidarität 135
Die horizontal begründete organische Solidarität 137
Entstehungsbedingungen horizontaler Solidarität 140
Die bewusste Verbundenheit 146
Die Unterordnung der affektiven Komponente
des mutual concern 152
Zwischenresümee 156
VI. Georg Simmel:
Konfliktuelle Beziehungen als Keim des mutual concern und die Öffnung des gesamtgesellschaftlichen Ganzen 158
Die Gesellschaft als Summe von Wechselwirkungen 159
Die Positivität von Konflikt: Konflikt als formale
Wechselwirkung 163
Die Produktivität von Konflikten als soziale Beziehungen 165
Die gesamtgesellschaftliche Produktivität von Konflikt 167
Im Inneren des Konflikts: Dualismus und gesellschaftliche
Einheit 170
Der nicht gemeinschaftliche Konflikt 174
Die horizontale Integration konfliktueller Beziehungen 177
Die »fließende« Einheit der Gesellschaft 180
Zwischenresümee 187
VII. Die nicht instrumentelle Beziehung des mutual concern
und die Gesellschaft als gemeinsames Projekt 189
Was bedeutet es, in einer Beziehung des mutual concern
zu stehen? 193
Die vertikale Vergemeinschaftung 198
Die horizontale Vergemeinschaftung 202
Gesellschaft als gemeinsames Projekt 205
Gemeinsame Praxis als Ermächtigung
und die Gestaltbarkeit sozialer Lebensumstände 212
Der Holismus als offener Interdependenzzusammenhang 217
Gemeinschaft als Ermächtigung 221
VIII. Ausblick: Die konfliktuelle Gemeinschaft 224
Die Beziehung des Politischen zum Sozialen 225
Die Kompatibilität des mutual concern mit radikalen Modellen 227
Konflikt als Moment des mutual concern 230
Die konfliktuelle Gemeinschaft 235
Literatur 239
Textauszug
Vorwort
Vor ein paar Jahren noch wurde in öffentlichen Debatten regelmäßig eine Wiederbelebung des Politischen gefordert. Die Demokratie sei eingeschlafen, im Konsensdenken erstarrt, zur Postdemokratie verkommen und bräuchte dringend mehr Leidenschaft, mehr Streit und mehr Einsatz. Be careful what you wish for, könnte man anfügen, denn heute, nicht mal eine Dekade später, stehen zahlreiche demokratische Gesellschaften des Westens unter einem hohen, permanenten Stress und fürchten die gesellschaftliche Spaltung. Die Wehrhaftigkeit von Demokratie stehe auf dem Prüfstand angesichts tiefgehender Dichotomien, heißt es nun, und allerorts wird die Frage diskutiert, wie wir als demokratische Gemeinschaft wieder zusammenwachsen können – und das ohne einem problematischen Nationalismus anheimzufallen.
Parallel zur öffentlichen Debatte zeichnete sich in der politischen Philosophie eine ähnliche Entwicklung ab. Zuerst hatten sogenannte radikale Theorien das etablierte, normativ-liberale Demokratieverständnis ordentlich aufgemischt, schließlich meldeten sich jedoch auch hier größere Zweifel an, auf welcher Grundlage man im Postfundamentalismus und angesichts der Allgegenwart von Konflikt – vor allem, wenn diese Ideen von rechts adaptiert werden – innerhalb einer offenen politischen Gemeinschaft positiv aufeinander bezogen bleiben kann.
Die vorliegende Untersuchung will dieser teilweise sehr festgefahrenen Debatte zu Fragen der Gemeinschaft in zeitgenössischen Demokratiemodellen noch einmal systematisch auf den Grund gehen, indem sie sozial-theoretische und radikaldemokratische Überlegungen zum Zusammenhalt miteinander ins Gespräch bringt. Ziel ist es, ein Umdenken in der Bedeutung von Gemeinschaft zu erreichen, das vor allem auch Missverständnissen über notwendige identitätslogische Grundlagen von Demokratie entgegenwirkt. Im Zuge dessen werden Bedingungen und Kriterien entwickelt, angesichts derer radikaler gesellschaftlicher Konflikt als demokratieverwirklichend verstanden werden kann, und anhand derer sich – im Umkehrschluss – gewisse andere Formen des Streits disqualifizieren.
Im Ergebnis legt dieses Buch dar, warum eine radikale Gemeinschaft nicht primär affektiv, sondern nur im Füreinander handeln verbürgt werden kann. Radikale politische Gemeinschaft ist als ein gemeinsames Projekt anzusehen, zu dessen Teil man sich im praktischen Handeln macht und das erst im Vollzug dieses Handelns transparent wird. Konfliktparteien sind dabei wechselseitige Ermöglichungsbedingungen dieser Zusammengehörigkeit. Aber nicht unbedingt oder notwendigerweise. Nur wenn die sozialontologische Tatsache einer Verwobenheit anerkannt wird, können wir einander über den Konflikt Anteile in einer radikaldemokratischen Gemeinschaft verwirklichen.
Danken für die Betreuung dieses Forschungsprojekts möchte ich zuvorderst Rahel Jaeggi, die einen Wert in ihm erkannte und sich für seine Förderung einsetzte, als es lediglich eine rudimentäre Idee auf drei luftigen Seiten gab, mit der ich mich am Graduiertenkolleg bewarb. Ihr Bestehen auf einem stärker soziologischen und sozialphilosophischen Zugriff hat dieser Untersuchung zudem erst ihre interessante und gewinnbringende Richtung gegeben – auch dafür bin ich ihr sehr dankbar. Martin Saar danke ich für die sehr kurzfristige Übernahme des Zweitgutachtens und die lange Anreise nach Berlin zur Verteidigung – aber vor allem auch für die genaue und kritische Lektüre, die mir zu einem wesentlich tieferen Verständnis meiner eigenen Arbeit verholfen hat. Ähnlich hilfreich und erhellend, schon seit Beginn der Promotion, waren die wöchentlichen Sitzungen des sozialtheoretischen Kolloquiums der Humboldt-Universität, in dem ich ganz neue Welten des gesellschaftskritischen Denkens und Sehens kennenlernen durfte.
Des Weiteren gilt mein Dank dem DFG-Graduiertenkolleg »Verfassung jenseits des Staates« und der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ohne das Stipendium am Graduiertenkolleg hätte ich diese Dissertation weder angefangen noch umgesetzt. Es ermöglichte mir, drei Jahre sehr frei und in einem sehr freundlichen Umfeld zu forschen, und unterstützte daneben einen längeren Aufenthalt an der New School in New York, der für die Weiterentwicklung dieser Studie entscheidend und in akademischer und politischer Hinsicht sehr bereichernd war. Fertigstellen konnte ich meine Dissertation mittels eines Abschlussstipendiums im Trajectories of Change-Programm der ZEIT-Stiftung, dessen wundervolles Team außerdem großartige Workshops und Forschungsreisen organisiert, an denen ich teilnehmen konnte. Der großzügige Druckkostenzuschuss für diese Veröffentlichung kommt ebenfalls von der ZEIT-Stiftung.
Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Isabell Trommer vom Campus Verlag, die die Veröffentlichung begleitet hat. Und über alle Maßen dankbar bin ich Malte Ibsen und Valerie Dietrich für die kritische Lektüre, den Zuspruch, und die vielen anregenden Diskussionen.
Einleitung: Radikale Demokratietheorien
und das Desiderat der Gemeinschaft
Den entscheidenden Anstoß für diese Untersuchung bot eine These Charles Taylors, die er vor mittlerweile fast 20 Jahren in seinem Aufsatz Wieviel Gemeinschaft braucht die Demokratie? (2001) erörterte. Auch damals war sie nicht neu, aber sie brachte den relationalen Aspekt eines alten demokratietheoretischen Topos treffend auf den Punkt: Demokratisch verfasste Gemeinwesen sind für ihren Erhalt auf eine bestimmte Art der Beziehung zwischen den Menschen angewiesen, so Taylor. Sie benötigen gemeinsame Grundlagen, die diese Beziehungen stiften und die aus einer Vielheit etwas Gemeinsames machen. Gemeinschaft ist somit eine wichtige Bedingung zur Herstellung dieser bestimmten Verbundenheit zwischen Menschen, über die wir die demokratische Gestaltung unseres sozialen Miteinanders als ein gemeinsames Unternehmen ansehen können. So weit, so intuitiv, könnte man meinen. Doch ist Taylors These auch angesichts des jüngsten Vorstoßes sogenannter radikaler Demokratiemodelle in die politische Philosophie noch aktuell? Können zeitgenössische Demokratietheorien diese gemeinschaftlichen Voraussetzungen erfüllen? Und warum sollten sie das überhaupt?
Radikale Theorien postulieren das demokratische Miteinander als einen unabgeschlossenen und antagonistischen Konfliktraum und ziehen die Idee einer politischen Gemeinschaft als erfassbare Ganzheit damit grundlegend in Zweifel. Indem radikale Ansätze die Idee der Einheit ablehnen, entledigen sie sich aber auch der üblichen Grundlagen zur Herstellung einer sozialen Verbundenheit zwischen Bürgern, die den Erhalt demokratischer Selbstregierung gewährleisten soll. Dieser scheinbare Widerspruch wird hier zum Anlass genommen, noch einmal grundlegend und systematisch über die Möglichkeiten gemeinschaftlicher Bindungen nachzudenken und dabei denjenigen Bindungen nachzuspüren, die eben auch ein radikaldemokratisch konzipiertes Gemeinwesen stützen können. Einerseits lässt sich die vorliegende Untersuchung dabei entscheidend von der Prämisse leiten, dass radikale Demokratietheorien als Demokratietheorien, ganz prinzipiell gesehen, ebenfalls einen bestimmten Zusammenhalt zwischen Gesellschaftsmitgliedern für ihre Verwirklichung bedürfen – besonders dann, wenn es um dissoziative Demokratiemodelle geht, in denen das gesellschaftliche Miteinander sich maßgeblich über Konflikte herstellt. Andererseits folgt sie der Gemeinschaftskritik radikaler Modelle in der konzeptionellen Einschränkung, die sie sich setzt, nämlich, dass dieser Zusammenhalt nicht länger im vorpolitischen Sinne »gemeinschaftlich« verbürgt werden kann.
Die Herausforderung besteht somit in der Klärung und Verdeutlichung, wie es die Mitglieder einer unbestimmten und konfliktuellen Gesellschaft bewerkstelligen können, Beziehungen miteinander einzugehen, die es ihnen erlauben, sich als gemeinsam handelnde Teilnehmer eines demokratischen Allgemeinen anzusehen. Anders ausgedrückt, geht es darum, wie konfliktuelle Beziehungen als produktiver Beitrag und als Ausdruck des Zusammenhaltes eines radikaldemokratischen Allgemeinen plausibilisiert werden können. Um diesen Modus der Verbundenheit im Konflikt herauszustellen, so die These dieses Buches, ist ein völliges Umdenken in Bezug auf die Verfasstheit und die Quellen sozialer Bindungen in der Demokratietheorie erforderlich. Instruktiv für dieses Umdenken wird vor allem der Blick zurück in die klassische Soziologie sein, die sich seit Tönnies mit verschiedenen Formen sozialen Zusammenhaltes auseinandergesetzt und mit Durkheim und Simmel alternative Quellen Zusammenhalt stiftender sozialer Bindungen anbieten kann, die sehr vielversprechend für eine konfliktuelle Konzeptualisierung von Gemeinschaft sind.
Die Anforderungen zeitgenössischer Demokratietheorien
Demokratietheoretisch identifiziert diese Studie das komplizierte Verhältnis zwischen einer lebendigen und streitbaren Demokratie und deren »sittlichen« Grundlagen als eine Spannung zwischen zwei vermeintlich gegensätzlichen Anforderungen, die an die Demokratie als das gemeinsame Vorhaben der Selbstregierung herangetragen werden. Es steht das Desiderat der Zusammengehörigkeit, das den Aspekt des gemeinsamen Vorhabens betont, einem Desiderat der fundamentalen Offenheit und Umkämpftheit gegenüber, das den Aspekt der pluralen Selbstregierung ernst nimmt.
Das erste Desiderat, Gemeinschaft als das Erfordernis einer »lebensfähigen und lebendigen« (Taylor 2001: 12) Demokratie, findet sich hauptsächlich in der normativen Politischen Theorie, wird dort teilweise jedoch sehr unterschiedlich begründet. Gemeinhin bedeutet Demokratie in dieser Tradition die Existenz rechtsstaatlich gesicherter Verfahren und Institutionen, die es den Bürgern ermöglichen, als Freie und Gleiche am demokratischen Entscheidungsfindungsprozess teilzunehmen. Die »solide Basis« eines demokratischen Gemeinwesens besteht folglich darin, »daß es von seinen Mitgliedern als eine Einrichtung wahrgenommen und verteidigt wird, die allen gleichermaßen Bürgerwürde garantiert« (ebd.: 21). Entscheidend und wesentlich ist dabei, »in welchem spezifischen Verhältnis die Bürger eines demokratischen Gemeinwesens zueinander stehen« (ebd.: 12). Eine gelingende Demokratie zeichnet sich insofern dadurch aus, so die treffende Beobachtung Charles Taylors, dass sie die an ihr Beteiligten auf eine bestimmte Art und Weise zueinander in Beziehung setzt, sodass diese sich als Beteiligte eines gemeinsamen demokratischen Projekts verstehen. Dieses Selbstverständnis als demokratische Gemeinschaft ist eines der wichtigsten Bedingungen zur Verwirklichung und zum Erhalt von Demokratie und setzt sich laut Taylor aus drei Komponenten zusammen: Einheit, Partizipation und gegenseitiger Respekt. Mit der Einheit meint er die Anerkennung des Gemeinwesens als ein gemeinsames Unternehmen und Gut. Es bedarf einer Identifikation mit dem demokratischen Gemeinwesen, um die Motivation dafür zu erzeugen, den »Anforderungen des Gemeinwesens Genüge zu tun und die Gemeinwohlforderungen im eigenen Handeln zu integrieren« (Rosa 1998: 442). Das heißt allerdings nicht, dass das Interesse an der Wahrung der Bürgerrechte der einzelnen Beteiligten konvergiert und sie sich sozusagen gemeinsam selbstverpflichten, diese Rechte zu verteidigen. Es bedeutet, dass man das demokratische Projekt als ein geteiltes Ziel versteht, das sich überdies nur gemeinsam verwirklichen lässt. Nur so können sich die Bürgerinnen und Bürger einander gegenüber auf eine besondere Weise verpflichtet fühlen, sich einander gegenüber solidarisch fühlen, was wiederum eine Voraussetzung dafür ist, dass sie das Gemeinwohl im Sinne gleicher Bürgerrechte auch tatsächlich verteidigen (Taylor 2011: 22). Taylor nennt diese Verantwortung und die Bereitschaft zur Herstellung genuin demokratischer Verhältnisse Patriotismus.
Aus der Bedingung der patriotischen Einheit geht die Bedingung der Partizipation hervor. Das Bewusstsein, an einem gemeinsamen Projekt teilzunehmen, muss beständig aktualisiert werden, sodass man sich auch weiterhin als Teil des »gemeinsamen Vorhabens der Selbstregierung« begreift. Unabhängig davon generiert die »Erfahrung« der Mitgestaltung außerdem einen wichtigen »Sinn für zivile Macht« und trägt dazu bei, dass diejenigen, die von den erlassenen Gesetzen betroffen sind, sich auch als die Urheber dieser Gesetze verstehen und sich für die Verteidigung dieses demokratischen Vorrechts gegenüber den herrschenden Institutionen einsetzen. In der republikanischen Demokratietheorie nach Taylor sichert die Figur der Gemeinschaft somit die notwendige Grundlage für Zugehörigkeit und Mitgestaltung, ohne die das demokratische Gesellschaftsprinzip einer freien und gleichen Assoziation von Individuen nicht realisiert werden kann. Ohne einen gewissen Grad der Einheit und ohne Partizipation herrschen Ungleichheit, Machtlosigkeit und Unfreiheit und haben Demokratien keinen Bestand. Gemeinschaft, so könnte man auch sagen, hat hier einen freiheits- und gleichheitsverbürgenden Wert. Damit zusammenhängend liegt ihre Verantwortung darin, den demokratischen Zusammenhalt dauerhaft zu sichern.
Hinter dem Desiderat der Zusammengehörigkeit verbirgt sich demnach die Idee, dass »only if citizens are linked by communal bonds of one kind or another are they likely to be willing to make compromises or sacrifices for the common good or accept the authority of shared institutions« (Mason 2000: 61). Demokratien würden nicht funktionieren, wenn ihre Mitglieder sich einander nicht verbunden fühlten und sich aufgrund dessen nicht füreinander einsetzten. Obwohl das Desiderat hier exemplarisch mit Taylor expliziert wurde, wird es nicht nur von republikanischen Positionen vertreten, sondern findet sich ebenso in liberalen, prozeduralen und nationalliberalen Demokratiemodellen , die sich allerdings in ihren Entwürfen zur Verfasstheit und zu den Grundlagen politischer Gemeinschaft unterscheiden.
In Anbetracht dieses demokratietheoretischen Desiderats normativer Ansätze wurden in den letzten beiden Dekaden kritische Bedenken laut. Es kam der Vorwurf auf, dass normative Demokratietheorien von Gemeinschaftsvorstellungen leben, die Ausschluss und Herrschaft begünstigen und produzieren, während sie behaupten, ein solidarisches und offenes Gemeinwesen zu erschaffen. In ihrer Konzeptualisierung von Gemeinschaft – sei es in nationalen, rechtlichen, moralischen, staatsbürgerlichen, kulturellen oder zivildemokratischen Bezügen – verkennt die normative Politiktheorie das eigentliche, das fragmentierte Wesen von politischer Gemeinschaft (siehe u. a. Böckelmann/Morgenroth 2008). Die Idealisierung von Gemeinschaft als Ort der Harmonie, der Zuflucht, der Teilhabe und der Zugehörigkeit beruht dabei auf einer machtgeleiteten und gefährlichen Fabrikation staatlicher und ideologischer Gewalt, die die Brüche, Diskontinuitäten, Herrschafts- und Ausgrenzungsdynamiken politischer Gemeinschaft zur Wahrung der eigenen Hegemonie verschleiern (vgl. u. a. Spitta 2013; vgl. Derrida 2002: 147ff.).
Hauptbeschreibung
Demokratische Gesellschaften brauchen Zusammengehörigkeit, darüber sind sich die meisten Menschen einig. Doch wie viel und welche Art der Verbundenheit in Demokratien geboten sind, um sich langfristig gemeinsam regieren zu können, ist ungleich strittiger. Ausgehend von radikalen Demokratietheorien, die keine Einheit, sondern eine fundamentale Offenheit und Konflikthaftigkeit an den Anfang des demokratischen Gemeinwesens stellen, erarbeitet dieses Buch eine neue Idee politischer Gemeinschaft. Sie lässt identitätslogische Vorstellungen von Zusammenhalt hinter sich und sieht im Vollzug konfliktueller Beziehungen eine wichtige Bedingung, sich wechselseitig als Anteile eines gemeinsamen demokratischen Projekts zu verwirklichen.
Informazioni sull'autore
Theresa Clasen ist Sozialphilosophin und arbeitet als Lektorin.
